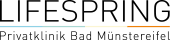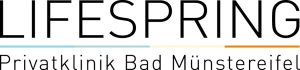Der chronische und zugleich sehr dynamische Verlauf von Suchterkrankungen erfordert kontinuierliche, adaptive Unterstützung (Kiefer et al., 2021). Entlang des typischen Behandlungspfades zeigen sich jedoch wiederholt Versorgungslücken. In der Frühintervention und Prävention erschweren Stigmatisierung und fehlende niedrigschwellige Zugänge die Hilfesuche (Schomerus et al., 2018). Im allgemeinen Versorgungssystem werden Suchterkrankungen als Komorbidität oft nur unspezifisch behandelt, weshalb gezielte Hilfen verspätet ankommen (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 2019). Vor spezifischen Therapien für Abhängigkeitserkrankungen entstehen Wartezeiten und es kommt an den Übergängen zwischen Entzug, Rehabilitation und Nachsorge zu Verzögerungen und Bruchstellen (Weissinger, 2016). Auch in der kritischen Phase nach der Entlassung aus einer stationären Behandlung finden betroffene Personen häufig nur vereinzelte Kontakte in der Nachsorge, der ambulanten Weiterbehandlung oder der Selbsthilfe, obwohl Rückfälle durch situative Auslöser hochdynamisch entstehen können (Möckl et al., 2023; Serre et al., 2015). Diese Diskontinuitäten erschweren eine kontinuierliche Verhaltensänderung und eine langfristige Rückfallprävention.
Digitale Unterstützungen können diese Zwischenräume überbrücken und bei der Strukturierung der nächsten Schritte helfen. Sie eröffnen niedrigschwellige ortsunabhängige Zugänge zu qualifizierter Beratung und Begleitung, sind durch weit verbreitete Technologien kosteneffizient implementierbar und auch außerhalb regulärer Sprechzeiten kontinuierlich verfügbar (Nesvåg & McKay, 2018). Außerdem fördern sie Selbsthilfe-Ansätze und Peer-Support-Strukturen und erlauben die kontinuierliche Erhebung von Verlaufsdaten, um Rückfälle frühzeitig zu erkennen und zeitnah zu intervenieren. Dadurch lassen sich therapiefreie Intervalle, Wartezeiten und Übergangsphasen wirksamer absichern, ohne klassische therapeutische Angebote vorauszusetzen oder zu ersetzen.
Im Bereich der Suchterkrankungen erweisen sich digitale Unterstützungen als besonders relevant. In diesem Blogbeitrag stellen wir die verschiedenen digitalen Ansätze vor, die in der Suchttherapie angewendet werden oder eingesetzt werden könnten.
Übersicht der für die Suchttherapie relevanten Anwendungen
Telemedizin umfasst die Bereitstellung medizinischer Dienstleistungen über digitale Kommunikationstechnologien. Im Suchtbereich ermöglicht sie ortsunabhängige und anonyme Beratung, Behandlung und Nachsorge. Die Vorteile liegen in der Überwindung geographischer Barrieren, der Reduktion von Stigmatisierung durch Anonymität und der flexiblen Verfügbarkeit außerhalb regulärer Sprechzeiten (Okobi et al., 2024). Ein Beispiel aus dem deutschen Versorgungssystem ist DigiSucht (https://www.suchtberatung.digital/). Die Online-Suchtberatungsplattform ist bundesweit seit Oktober 2022 kostenfrei verfügbar und vernetzt über 390 Beratungsstellen mit mehr als 1.000 Fachkräften aus 13 Bundesländern. 2023 registrierten sich pro Monat ca. 400 Ratsuchende auf der Plattform (delphi Gesellschaft, 2024). Die Mehrheit der Ratsuchenden (72 %) nutzt die Beratungen via Nachrichten, während 24 % auf Videochats zurückgreifen (delphi Gesellschaft, 2024). Für etwa 5 % der Ratsuchenden wurde zudem mindestens eine Beratung vor Ort dokumentiert (delphi Gesellschaft, 2024). DigiSucht demonstriert somit das Potenzial von niedrigschwelligen telemedizinischen Lösungen, um Ratsuchende zu erreichen und erfolgreich in das Hilfesystem zu leiten.
Streak- und Quit-Counter sind digitale Zähler, die abstinente Zeiträume visualisieren und Meilensteine markieren. Sie digitalisieren damit ein bewährtes Prinzip von Selbsthilfegruppen wie den Anonymen Alkoholikern (AA) und Narcotics Anonymous (NA), bei denen Münzen für erreichte Abstinenz-Meilensteine vergeben werden. Diese Selbsthilfe-Apps fördern die Selbstbeobachtung, stärken die Motivation durch sichtbare Erfolgserlebnisse und bieten einen niedrigschwelligen Einstieg in die Verhaltensänderung. Durch diese Art der Gamifizierung können sie die Aufrechterhaltung der Abstinenz unterstützen (Imran Ho et al., 2025). Ein Beispiel einer solchen Anwendung ist Quitzilla (https://quitzilla.com/). In der App können Gewohnheiten dokumentiert und die Abstinenzdauer eingesehen werden. Ein Anreizsystem visualisiert Belohnungen, sobald selbstgesteckte Ziele erreicht werden. Fast 100.000 Google-Play-Bewertungen deuten auf hohe Nutzung hin.
Reflexions-, Psychoedukations- und verhaltenstherapeutische Apps bieten strukturierte Inhalte und Übungen zu Craving-Management, Motivation, Reflexion und Kompetenzaufbau. Sie erweitern die Therapie in den Alltag, ermöglichen ein individuelles Lerntempo und können zwischen Sitzungen kontinuierliche Unterstützung bieten (Serre et al., 2023). Diese Apps zeichnen sich durch hochqualitative, oft evidenzbasierte Inhalte aus und können in spezifischen Abschnitten der Behandlungspfade eingesetzt werden. Ein hoher Qualitätsstandard dieser Anwendungen zeigt sich in Form von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs). Als evaluierte Medizinprodukte können sie von Ärzt:innen verschrieben und von Krankenkassen erstattet werden. Ein Beispiel ist die DiGA Smoke Free (https://smokefree.de/) zur Raucherentwöhnung, die Funktionen wie Streak-Counter, Zielsetzung und Coaching kombiniert. In einer großen randomisierten kontrollierten Studie (n=3143) konnte gezeigt werden, dass diese Raucherentwöhnungs-App bei aktiver Nutzung signifikant höhere Abstinenzraten erzielte als eine reine Aufklärung zum Rauchstopp (Jackson et al., 2024). So können auch Hausärzt:innen bei kurzen Konsultationszeiten evidenzbasierte Unterstützung anbieten.
Community- und Selbsthilfegruppen-Apps schaffen digitale Räume für Peer-Support, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Motivation. Bei kontinuierlicher Teilnahme gelten Selbsthilfegruppen, in Ergänzung zur professionellen Therapie, als ein sehr effektives Werkzeug, um langfristig höhere Abstinenzraten zu erzielen und Isolation zu reduzieren (Tracy & Wallace, 2016). Digitale Plattformen erweitern dieses bewährte Prinzip um entscheidende Vorteile wie ständige Verfügbarkeit und die Überwindung geographischer Barrieren (Beck et al., 2023). Ein Beispiel einer solchen Plattform ist die US-amerikanische Plattform Sober Grid, die über 300.000 Mitglieder in mehr als 170 Ländern vernetzt. In Deutschland bieten Angebote wie Groupera (www.groupera.de), digitale Selbsthilfegruppen zu verschiedenen Krankheitsbildern per Videokonferenz an. Laut Groupera empfehlen 90 % der Nutzer:innen das Angebot weiter, und 93 % bestätigen, dass die Gruppentreffen ihnen im Umgang mit ihrer Erkrankung helfen. Selbsthilfe bleibt somit ein essenzieller Baustein für die langfristige Aufrechterhaltung der Abstinenz bei Abhängigkeitserkrankungen. Während die Wirksamkeit von Präsenzgruppen als gesichert gilt, können digitale Angebote diese wirksam erweitern oder den Zugang für jene Personen erst ermöglichen, die aus geografischen, gesundheitlichen oder persönlichen Gründen nicht an Treffen vor Ort teilnehmen können.
In der ambulanten Suchttherapie stellt die Einschätzung des tatsächlichen Zustands von Patient:innen eine zentrale Herausforderung dar. Berichte in Therapiesitzungen sind oft durch Erinnerungslücken (Recall bias) oder den unbewussten Wunsch, ein positives Bild zu vermitteln (soziale Erwünschtheit) verzerrt (Gnambs & Kaspar, 2015; Althubaiti, 2016). Apps, die mittels Ecological Momentary Assessments (EMA) und digitalen Biomarkern Daten direkt im Alltag erfassen, können diese Lücke schließen und ein objektives Bild liefern. EMA bezeichnet eine Methode zur wiederholten Erfassung von Verhalten, Emotionen und Symptomen in der natürlichen Lebensumgebung der Patient:innen mittels kurzer, zeitnaher Befragungen. Die App A-CHESS ist ein Beispiel einer App, die EMA ermöglicht. Sie erfasst emotionalen Zustand, Verlangen, Stresslevel und weitere Kontextfaktoren und schlägt beispielsweise bei Angabe eines hohen Verlangens Achtsamkeitsübungen oder den Kontakt zur Unterstützungsgruppe vor. In einer randomisierten kontrollierten Studie konnte gezeigt werden, dass A-CHESS-Nutzer:innen signifikant weniger riskante Trinktage verzeichneten als die Kontrollgruppe (1,39 vs. 2,75 Tage) (Gustafson et al., 2014). Obwohl EMA den Recall Bias reduziert, basiert die Methode weiterhin auf der subjektiven Wahrnehmung der Patient:innen. Um diese Perspektive zu objektivieren, können EMA-Daten durch objektive und passiv erfasste digitale Biomarker ergänzt werden. Dabei handelt es sich um quantifizierbare Messungen (z. B. Herzfrequenzvariabilität, Schlafmuster, Aktivitätslevel), die über Smartphones oder Wearables gesammelt werden. Kombiniert man beide Ansätze, können potenziell kritische Momente mit hoher Genauigkeit erfasst werden, um so zeitnah passende digitale Interventionen oder proaktive Kriseninterventionen bereitzustellen.
Die transdermale Detektion ist ein Verfahren, bei dem elektrochemische Sensoren konsumierte Substanzen kontinuierlich über die Ausscheidung im Hautschweiß messen. Dieses Monitoring liefert objektive Konsumdaten und ermöglicht es, die Abstinenz der Patient:innen auch im ambulanten Setting zu kontrollieren. Die gewonnenen Daten dienen als Grundlage für Therapieanpassungen und könnten potenziell herkömmliche, invasive Testmethoden wie Urin- oder Bluttests ersetzen. Für Patient:innen kann das Wissen um ein kontinuierliches Monitoring, ähnlich wie bei anderen chemischen Tests, die Abstinenzmotivation stärken (American Society of Addiction Medicine, 2010). Ein konkretes Produkt, das diese Technologie nutzt, ist das primär für Forschungszwecke entwickelte BACtrack Skyn (https://skyn.bactrack.com/). Der Sensor, der als unauffälliges Armband getragen oder in ein Apple Watch-Armband integriert werden kann, misst alle 20 Sekunden die transdermale Alkoholkonzentration. Aus diesen Daten schätzt das System die Blutalkoholkonzentration (BAK) und überträgt die Werte an eine Smartphone-App zur Visualisierung. Die hohe Praxistauglichkeit und Nutzerakzeptanz wurde in einer randomisiert-kontrollierten Machbarkeitsstudie gezeigt. Durch das unauffällige Design und die einfache Handhabung erklärten sich 96 % der Proband:innen bereit, das Gerät dauerhaft zu tragen (Brobbin et al., 2025).
Auch Virtual Reality (VR) eröffnet neue Wege in der Suchttherapie, insbesondere durch die sogenannte Cue-Exposure-Therapie (VR-CET). Die Expositionstherapie ist ein in der Therapie von Alkoholkonsumstörungen bereits etabliertes und wirksames Verfahren (Kiyak et al., 2023). In der Praxis scheitert die Umsetzung jedoch oft am hohen Aufwand. Es fehlen geeignete Räumlichkeiten, die zu einem möglichst realen Szenario führen, und komplexe soziale Trigger-Szenarien, wie beispielsweise ein Grillabend, sind kaum reproduzierbar. In einem sicheren, virtuellen Raum können Patient:innen jedoch gezielt mit ihren individuellen Sucht-Triggern konfrontiert werden. Systeme wie das „VR coach® smart system“ (https://www.vr-coach.at/) ermöglichen dabei eine detaillierte Personalisierung der Szenarien durch unterschiedliche Umgebungen, soziale Settings und sogar spezifische Trigger-Sätze. Die Vorteile dieses Ansatzes liegen in vollständig kontrollierbaren Expositionsbedingungen und einer höheren Patientenakzeptanz im Vergleich zur Konfrontation in der Realität (Mazza et al., 2021). Studien zeigen bereits, dass durch VR-CET das Craving und die damit verbundenen Ängste signifikant reduziert werden können (Nègre et al., 2023). In unserem Blogpost „Virtual-Reality-Anwendungen bei Patienten mit Substanzgebrauchsstörung“ können Sie mehr über diesen Ansatz erfahren.
Therapeutische Chatbots sind KI-gestützte Gesprächspartner, die Betroffenen psychologische Unterstützung und erste Interventionen bieten. Ihr zentraler Mehrwert liegt in der sofortigen Verfügbarkeit außerhalb regulärer Therapiezeiten. In akuten Krisenmomenten ermöglichen sie unmittelbaren Zugang zu erlernten Strategien, Deeskalationstechniken und Motivation, wenn Therapeut:innen nicht erreichbar sind (Ogilvie et al., 2022). In Deutschland treibt das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projekt „Sucht GPT“ die Entwicklung eines datenschutzkonformen Chatbots voran, wobei zentrale Akteure der Suchthilfe und die Zielgruppe selbst aktiv eingebunden werden. Für ein ähnliches Konzept aus den USA, dem Woebot-SUD, konnte schon gezeigt werden, dass ein solches System das Selbstvertrauen der Teilnehmenden zur Abstinenz steigerte und gleichzeitig Konsum und Cravings verringerte (Prochaska et al., 2023). Die aktuelle Forschung deutet darauf hin, dass insbesondere jüngere Nutzer:innen und solche mit weniger schweren Krankheitsbildern von diesen Lösungen profitieren (Lee et al., 2024). Chatbots sind als Ergänzung zu verstehen und sollten keinen Ersatz der therapeutischen Beziehung darstellen. Sie können als niedrigschwellige erste Anlaufstelle den Weg in das professionelle Hilfesystem ebnen oder zwischen Therapiesitzungen begleiten. Die therapeutische Beziehung zwischen Mensch und Mensch ist dadurch aber nicht ersetzbar.
Herausforderungen
Trotz des erheblichen Potenzials der unterschiedlichen digitalen Unterstützungen in der Suchttherapie bestehen Herausforderungen, die die Implementierung bremsen (Hautala et al., 2024).
Die Datensicherheit stellt eine zentrale Anforderung an digitale Gesundheitsanwendungen dar, da Suchterkrankungen besonders stigmatisiert sind und Betroffene auf absolute Vertraulichkeit angewiesen sind (Schomerus et al., 2018; Bitkom e.V., 2024). Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten personenbezogenen Informationen und erfordern höchste Schutzstandards gemäß Artikel 9 der DSGVO (Europäische Union, 2016, Art. 9 Abs. 1). Anbieter müssen deshalb sichere, verschlüsselte Plattformen bereitstellen. Die Herausforderung liegt darin, innovative Funktionalitäten mit strengen Datenschutzanforderungen zu vereinbaren, ohne die Nutzererfahrung und Weiterentwicklung digitaler Innovationen zu beeinträchtigen.
Die Qualität und Evidenz digitaler Unterstützungen variieren erheblich. Viele der verfügbaren Angebote verfügen nicht über ausreichend robuste wissenschaftliche Belege (Johansson et al., 2024). Entscheidend sind Patient:innen-relevante Endpunkte (Abstinenz, Rückfälle, Lebensqualität) und Dauerhaftigkeit der Effekte. Systematische Übersichten zu digitalen Gesundheitsanwendungen in der Psychiatrie zeigen zwar vorhandene Behandlungseffekte, weisen jedoch auf methodische Defizite wie unzureichende Langzeitbeobachtung und die geringe Anzahl an hochqualitativen Studien hin (Linardon et al., 2025). Nutzer:innen und Fachkräfte sollten daher Qualitätskriterien wie evidenzbasierte Inhalte, Transparenz bezüglich Entwicklung und Finanzierung, regulatorische Anerkennung (z.B. Medizinprodukt-Status oder eine DiGA-Listung) und wissenschaftliche Evaluationen prüfen, bevor sie digitale Tools in die Behandlung integrieren.
Während digitale Angebote den Zugang zur Therapie und die Teilhabe erheblich erleichtern, schaffen sie zugleich neue Barrieren durch variierende digitale Kompetenzen, ungleichen Technik-Zugang und mangelnde Barrierefreiheit (Batra & Petersen, 2021). Die Inanspruchnahme digitaler Gesundheitsangebote ist stark mit soziodemographischen Faktoren assoziiert (Baumann et al., 2017). Allgemein zeigt sich, dass die Inanspruchnahme bei jüngeren Menschen und solchen mit höherer Bildung und höherem Einkommen verbreiteter ist (Baumann et al., 2017). Die Gefahr der digitalen Ausgrenzung betrifft insbesondere ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, obwohl gerade diese oft einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Damit digitale Gesundheitsangebote ihr Potenzial ausschöpfen, ohne Ungleichheiten zu verstärken, muss Inklusion von Anfang an in Konzeption und Umsetzung verankert sein. Dies erfordert einen klaren Fokus auf barrierefreie Designs und vielfältige Zugangswege.
Praxisbeispiel coobi care
Ein Beispiel für ein digitales Tool in der Suchttherapie, welches viele verschiedene evidenzbasierte digitale Ansätze kombiniert, ist coobi care. Die Lifespring Privatklinik Bad Münstereifel bietet Patient:innen dieses innovative Tool an, um sie auch nach der Therapie und über einen Zeitraum von sechs Monaten in Kombination mit monatlichen telemedizinischen Gesprächen zu begleiten. coobi care besteht aus einer App, einer Smartwatch und einem Therapeut:innen-Dashboard. Die App bündelt mehrere Funktionen:
- Psychoedukative und verhaltenstherapeutische Module mit alltagsnahen Übungen
- Abstinenztage‑Zähler
- Chat für den Austausch mit Mitpatient:innen oder Nachsorgegruppen
- Regelmäßige Reflexion zu Cravings, Stimmung und Konsum
- Passive Erfassung digitaler Biomarker (z. B. HRV, Schlaf, Aktivität) per Smartwatch und Einblick in die eigenen Daten
Basierend auf den erhobenen Informationen entsteht ein ganzheitliches Bild der aktuellen Situation der Patient:innen, aus dem personalisierte Unterstützung abgeleitet wird. So erhalten Nutzer:innen in relevanten Momenten Atemübungen, passende Lernmodule oder die Empfehlung, eine Vertrauensperson zu kontaktieren. Mit Einwilligung werden App- und Smartwatch-Daten im Therapeut:innen-Dashboard sichtbar, sodass Gespräche gezielt und bedarfsorientiert gesteuert werden können.
coobi care ist als Medizinprodukt zertifiziert und erfüllt die Datenschutzstandards (DSGVO-konform, moderne Verschlüsselung, strikte Datenminimierung, etc.). Besonders ist, dass das Produkt vollständig pseudonym genutzt werden kann.
Damit unterstützt coobi care die Suchtbehandlung präzise, kontinuierlich und persönlich, adressiert strukturelle Herausforderungen und erweitert die bestehende Therapie sinnvoll. Aktuell wird das Tool in mehreren Studien evaluiert.
Fazit und Ausblick
Digitale Unterstützungen können zentrale Lücken entlang des suchttherapeutischen Behandlungspfads schließen, indem sie niedrigschwelligen Zugang, kontinuierliches Monitoring und neue Möglichkeiten der Intervention bereitstellen, ohne die therapeutische Beziehung zu ersetzen. Gleichzeitig erfordern Datenschutz, Evidenzqualität und digitale Inklusion konsequente Priorität. Das Praxisbeispiel coobi care zeigt, wie ein integriertes, datengestütztes Ökosystem aus App, Wearable und Therapeut:innen-Dashboard die kontinuierliche Betreuung präzise und bedarfsorientiert stärkt und so den Weg zu einer neuen Art der Suchttherapie weist.
Literaturverzeichnis
American Society of Addiction Medicine. (2010). Public policy statement on drug testing as a component of addiction treatment and monitoring programs and in other clinical settings. American Society of Addiction Medicine.
Batra, A., & Petersen, K. U. (2021). S3-Leitlinie „Rauchen und Tabakabhängigkeit: Screening, Diagnostik und Behandlung“ (AWMF-Registernummer 076-006). Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften.
Baumann, E., Czerwinski, F., & Reifegerste, D. (2017). Digital Divide – Soziale Unterschiede in der Nutzung digitaler Gesundheitsangebote. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 60(2), 185–191. https://doi.org/10.1007/s00103-016-2493-y
Beck, A. K., Waks, S., Argent, A., Deane, F. P., Larance, B., Manning, V., Baker, A. L., Hides, L., & Kelly, P. J. (2023). The benefits and challenges of virtual SMART recovery mutual-help groups: Participant and facilitator perspectives. International Journal of Drug Policy, 120, 104174. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104174
Brobbin, E., Drummond, C., Parkin, S., & Deluca, P. (2025). Use of wearable transdermal alcohol sensors for monitoring alcohol consumption after detoxification with contingency management: Pilot randomized feasibility trial. JMIR Human Factors, 12, e64664. https://doi.org/10.2196/64664
Bundesministerium für Gesundheit. (2023). Gemeinsam digital: Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege.https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/D/Digitalisierungsstrategie/BMG_Broschuere_Digitalisierungsstrategie_bf.pdf
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (2024). Digitale Gesundheitsanwendungen: Get started – Ein Whitepaper für Unternehmen.https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-07/bitkom-get-started-diga-whitepaper.pdf
delphi Gesellschaft für Forschung, Beratung und Projektentwicklung mbH. (2024). Sachbericht DigiSucht. Berlin. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Abschlussbericht/Sachbericht_DigiSucht.pdf
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (2019). Die Versorgung von Menschen mit Suchtproblemen in Deutschland: Analyse der Hilfen und Angebote & Zukunftsperspektiven – Update 2019. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
El Hayek, S., Foad, W., de Filippis, R., Ghosh, A., Koukach, N., Mahgoub Mohammed Khier, A., Pant, S. B., Padilla, V., Ramalho, R., Tolba, H., & Shalbafan, M. (2024). Stigma toward substance use disorders: A multinational perspective and call for action. Frontiers in Psychiatry, 15, 1295818. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1295818
Ezeamii, V. C., Okobi, O. E., Wambai-Sani, H., Perera, G. S., Zaynieva, S., Okonkwo, C. C., Ohaiba, M. M., William-Enemali, P. C., Obodo, O. R., & Obiefuna, N. G. (2024). Revolutionizing healthcare: How telemedicine is improving patient outcomes and expanding access to care. Cureus, 16(7), e63881. https://doi.org/10.7759/cureus.63881
Europäische Union. (2016). Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).Amtsblatt der Europäischen Union, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Gnambs, T., & Kaspar, K. (2015). Disclosure of sensitive behaviors across self-administered survey modes: A meta-analysis. Behavior Research Methods, 47(4), 1237–1259. https://doi.org/10.3758/s13428-014-0533-4
Hautala, S., Kivist, M., Romakkaniemi, M., Kuusisto, K., Granholm, P., Lassila, A., & Karjalainen, K. (2024). Navigating challenges and opportunities: Perspectives on digital service development in substance use disorder treatment. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 19, Article 36. https://doi.org/10.1186/s13011-024-00618-6
Imran Ho, D. S. H., Jabir, F., Sallahuddin, S. N., Mohd Ahwan, N. A., Sathiyaseelan, G., Zahari, M. I., Hassan, M. R., & Mohammed Nawi, A. (2025). The impact of gamification on smoking cessation: A systematic review and meta-analysis. Tobacco Induced Diseases, 23(June), 84. https://doi.org/10.18332/tid/203
Jackson, S., Kale, D., Beard, E., Perski, O., West, R., & Brown, J. (2024). Effectiveness of the offer of the Smoke Free smartphone app compared with no intervention for smoking cessation: Pragmatic randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 26, e50963. https://doi.org/10.2196/50963
Johansson, M., Romero, D., Jakobson, M., Heinemans, N., & Lindner, P. (2024). Digital interventions targeting excessive substance use and substance use disorders: A comprehensive and systematic scoping review and bibliometric analysis. Frontiers in Psychiatry, 15, 1233888. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1233888
Kiefer, F., Hoffmann, S., Hoch, E., Batra, A., Bonnet, U., Günthner, A., Reymann, G., Schäfer, M., Beutel, M., Bischof, G., Demmel, R., Freyer-Adam, J., Funke, W., Gouzoulis-Mayfrank, E., Havemann-Reinecke, U., Klein, M., Kremer, G., Lindenmeyer, J., Mueller, S., Preuss, U. W., Thomasius, R., Veltrup, C., Weissinger, V., & Wodarz, N. (2021). S3-Leitlinie Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen – Aktualisierung 2021 – Kurzfassung. SUCHT, 67(2), 59–102. https://doi.org/10.1024/0939-5911/a000750
Kiyak, C., Simonetti, M. E., Norton, S., & Deluca, P. (2023). The efficacy of cue exposure therapy on alcohol use disorders: A quantitative meta-analysis and systematic review. Addictive Behaviors, 139, 107578. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107578
Lee, S., Yoon, J., Cho, Y., & Chun, J. (2024). A systematic review of chatbot-assisted interventions for substance use. Frontiers in Psychiatry, 15, 1456689. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1456689
Linardon, J., Xie, Q., Swords, C., Torous, J., Sun, S., & Goldberg, S. B. (2025). Methodological quality in randomised clinical trials of mental health apps: Systematic review and longitudinal analysis. BMJ Mental Health, 28(1), e301595. https://doi.org/10.1136/bmjment-2025-301595
Mazza, M., Kammler-Sücker, K., Leménager, T., Kiefer, F., & Lenz, B. (2021). Virtual reality: A powerful technology to provide novel insight into treatment mechanisms of addiction. Translational Psychiatry, 11, Article 617. https://doi.org/10.1038/s41398-021-01739-3
Möckl, J., Rauschert, C., Wilms, N., Langenscheidt, S., Kraus, L., & Olderbak, S. (2023). Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2021. Tabellenband: (problematischer) Alkoholkonsum und episodisches Rauschtrinken nach Geschlecht und Alter im Jahr 2021. IFT Institut für Therapieforschung. https://www.esa-survey.de/ergebnisse/kurzberichte.html
Negre, F., Lemercier-Dugarin, M., Kahn-Lewin, C., Gomet, R., Zerdazi, E. H. M., Zerhouni, O., & Romo, L. (2023). Virtual reality efficiency as exposure therapy for alcohol use: A systematic literature review. Drug and Alcohol Dependence, 253, 111027. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2023.111027
Nesvåg, S., & McKay, J. R. (2018). Feasibility and effects of digital interventions to support people in recovery from substance use disorders: Systematic review. JMIR mHealth and uHealth, 20(8), e9873. https://doi.org/10.2196/mhealth.9873
Ogilvie, L., Prescott, J., & Carson, J. (2022). The use of chatbots as supportive agents for people seeking help with substance use disorder: A systematic review. European Addiction Research, 28(6), 405–418. https://doi.org/10.1159/000525959
Serre, F., Fatseas, M., Swendsen, J., & Auriacombe, M. (2015). Ecological momentary assessment in the investigation of craving and substance use in daily life: A systematic review. Drug and Alcohol Dependence, 148, 1–20. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.12.024
Serre, F., Fatseas, M., Moriceau, S., Denis, C., & Auriacombe, M. (2023). The Craving-Manager smartphone app designed to diagnose and reduce addictive use: Study protocol for a randomized controlled trial. Frontiers in Psychiatry, 14, 1143167. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1143167
Tracy, K., & Wallace, S. P. (2016). Benefits of peer support groups in the treatment of addiction. Substance Abuse and Rehabilitation, 7, 143–154. https://doi.org/10.2147/SAR.S81535