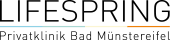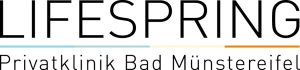Einleitung
Suchterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und stellen das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Sie betreffen nicht nur die Gesundheit, sondern auch das soziale und berufliche Leben der Betroffenen. Um Behandlungen noch wirksamer zu gestalten, braucht es Angebote, die über klassische stationäre Therapie und ambulante Therapiesitzungen hinausgehen und kontinuierlich in den Alltag der Patient:innen integriert werden können. Digitale Technologien eröffnen neue Möglichkeiten in der Versorgung. Besonders vielversprechend ist dabei das Innovationspotenzial digitaler Biomarker. Diese erlauben eine kontinuierliche Erfassung von Gesundheits- und Verhaltensdaten im Alltag und bieten damit die Chance, auch im ambulanten Setting Veränderungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu unterstützen. Gerade in der Rückfallprävention könnten digitale Biomarker ein zentrales Instrument werden, um personalisierte Therapien umzusetzen und Patient:innen besser durch den Alltag zu begleiten (Seyhan & Carini, 2019).
Was sind digitale Biomarker?
Ein Biomarker ist ein messbarer Indikator für einen biologischen Zustand oder eine Reaktion auf eine Behandlung (Coravos et al., 2019). Digitale Biomarker übertragen dieses Konzept in die digitale Welt. Sie basieren auf Daten, die durch tragbare Geräte, Smartphones oder Sensoren erfasst werden, und messen physiologische Werte wie Herzfrequenz über Photoplethysmographie (PPG), Schlaf und Aktivität über Beschleunigungssensoren oder Sprachmuster über das Mikrophon (Kalali et al., 2019). Im Gegensatz zu klassischen Biomarkern, die meist durch eine Messung oder Laborprobe punktuell in einem klinischen Setting erhoben werden, ermöglichen digitale Biomarker eine kontinuierliche, alltagsnahe Messung außerhalb der Klinik. So können sie dazu genutzt werden, Veränderungen oder das Auftreten von Erkrankungen in Echtzeit zu erfassen (Motahari-Nezhad et al., 2022).
Entwicklung
In den letzten Jahren hat sich die Forschung zu digitalen Biomarkern rasant entwickelt. Getrieben durch bessere Sensorik, sinkende Kosten, leistungsfähigere Computer und Fortschritte im maschinellen Lernen ist ein dynamisches Feld entstanden, das zunehmend wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhält (Rodler et al., 2019). Während der Begriff bis 2014 kaum verwendet wurde, wurden zwischen 2014 und 2023 bereits über 400 wissenschaftliche Arbeiten mit direktem Bezug zu dem Thema veröffentlicht (Alonso et al., 2023).
Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Verbreitung von Wearables. 2023 nutzte etwa jede fünfte Person in den USA regelmäßig tragbare Geräte zur Beobachtung der eigenen Gesundheit (Kaplan et al., 2023). Diese Alltagstechnologien liefern wertvolle Gesundheitsdaten zu niedrigen Kosten und stellen einen enormen Vorteil für klinische Forschung und Versorgung dar.
Typen digitaler Biomarker
Digitale Biomarker lassen sich in drei funktionale Gruppen einteilen:
Diagnostische digitale Biomarker helfen, Krankheiten zu erkennen. In einer Studie von Avram et al. (2020) wurde etwa ein System entwickelt, das über Smartphone kamerabasierte Photoplethysmographie-Signale Diabetes mit hoher Genauigkeit diagnostizieren konnte.
Prognostische digitale Biomarker sagen den Verlauf einer Erkrankung vorher. Buegler et al. (2020) zeigten in einer Längsschnittstudie, dass sich das Fortschreiten kognitiver Beeinträchtigungen bis hin zu Demenz mithilfe digitaler Tests zuverlässig vorhersagen lässt. Grundlage war ein digitaler Neuro Motor Index (NMI), der aus Handy-Nutzungsdaten bei alltagsnahen Augmented-Reality-Aufgaben auf dem Smartphone berechnet wurde.
Prädiktive digitale Biomarker geben Hinweise darauf, wie eine Person auf eine bestimmte Therapie reagieren könnte. Prädiktive Biomarker haben in vielen Bereichen der Medizin ein großes Potenzial und könnten auch in der Behandlung von Suchterkrankungen eine wichtige Rolle spielen: Carreiro et al. (2020) zeigten, dass tragbare Sensoren Craving- und Stress-Episoden mit einer Genauigkeit von bis zu 77 % erkennen können. Solche Erkennungssysteme könnten in Zukunft helfen, rechtzeitig gezielte Anpassungen von Therapien wie Anti-Craving-Medikamente oder verhaltenstherapeutische Interventionen einzuleiten.
Ein einzelner digitaler Biomarker kann mehreren Kategorien zugeordnet werden. Die genaue Einteilung richtet sich nach dem jeweiligen Anwendungszweck.
Potenzial für die Suchttherapie
Ein wesentlicher Vorteil digitaler Biomarker liegt in der kontinuierlichen Erhebung longitudinaler Daten. Sie ermöglichen nicht nur punktuelle Einblicke, sondern auch ein Verständnis für zeitliche Verläufe, Muster und Zusammenhänge wie beispielsweise zwischen Schlaf, Stimmung und Craving (Meister et al., 2016). Solche Muster können Vorboten kritischer Zustände im Therapieverlauf sein. Durch ihre frühzeitige Erkennung können individuelle Risiko-Situationen identifiziert werden, in welchen eine Rückfallgefahr besonders hoch ist.
Ein vielversprechender Anwendungsbereich ist die präsymptomatische Erkennung von Krisen. Bei vielen psychischen Erkrankungen, einschließlich Suchterkrankungen, gehen physiologische Veränderungen oft dem subjektiven Erleben voraus (Zhang et al., 2019). Zhang et al. (2019) zeigten, dass sich Suizidalität und der Schweregrad einer Depression aus Sprachmustern ableiten lassen, bevor Patient:innen diese bewusst wahrnehmen. Auch in der Medikamentenentwicklung und klinischen Forschung spielen digitale Biomarker eine immer größere Rolle. Ford & Corkey (2023) betonen, dass die Nutzung von Echtzeitdaten aus Wearables klinische Studien effizienter macht, da weniger Klinikbesuche nötig sind und die Datengenauigkeit durch kontinuierliche Messungen steigt. Darüber hinaus ermöglichen große Datensätze, die in Alltagsumgebungen erhoben werden, völlig neue Einblicke in Krankheitsmechanismen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz lassen sich bisher unbekannte Biomarker oder krankheitstypische Muster identifizieren (Wicks, 2015). Schließlich unterstützen digitale Biomarker auch die Umsetzung personalisierter Therapieansätze, indem sie individuelle Risikosituationen frühzeitig erkennen. Juarascio et al. (2020) zeigten beispielsweise, dass sich emotionale Essanfälle mithilfe von HRV-Daten bis zu 30 Minuten vor ihrem Auftreten vorhersagen lassen..
Neben objektiven Messwerten wie Herzfrequenz oder Aktivitätslevel sind auch subjektive Angaben der Patient:innen entscheidend. Diese werden in Form von Patient-Reported Outcomes (PROs) erfasst und spielen eine zentrale Rolle in der Suchttherapie. PROs umfassen unter anderem Angaben zur Stimmung, Konsum, Stresserleben oder Craving und werden direkt durch die Betroffenen selbst erhoben, etwa über standardisierte Fragebögen in einer App. Studien zeigen, dass diese subjektiven Daten einen wichtigen prognostischen Wert haben und helfen können, den Therapieverlauf besser zu steuern (Snyder et al., 2018). Besonders wirkungsvoll ist die Kombination aus digitalen Biomarkern und PRO. Während digitale Biomarker unbewusste, physiologische Veränderungen erfassen, geben PROs Einblick in das Erleben und Verhalten der Betroffenen. Gemeinsam ergeben sie ein ganzheitliches Bild, das personalisierte Interventionen deutlich präziser ermöglicht.
Herausforderungen
Trotz dieser Fortschritte gibt es weiterhin wesentliche Herausforderungen. Die Menge, Vielfalt und Geschwindigkeit der erhobenen Daten stellt hohe Anforderungen an Infrastruktur und Analyseverfahren (Meister et al., 2016). Gleichzeitig fehlt es an einer allgemein akzeptierten Definition des Begriffs „digitaler Biomarker“. In einem systematischen Review identifizierten Alonso et al. (2023) 127 verschiedene Definitionen in der Fachliteratur, was den Vergleich und die Weiterentwicklung erschwert.
Auch auf technischer Ebene bestehen Grenzen. Trotz großer Fortschritte weisen viele tragbare Sensoren noch Ungenauigkeiten auf, wie zum Beispiel bei der HRV-Messung in Bewegung (Wen et al., 2017). Zudem sind Methoden des maschinellen Lernens anfällig für Verzerrungen, wenn Trainingsdaten nicht repräsentativ sind.
Ein weiteres Hindernis ist die Integration in bestehende Gesundheitssysteme. Der medizinische Sektor ist stark reguliert, was die Anwendung innovativer Entwicklungen verlangsamt. Gleichzeitig müssen hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards eingehalten werden, da es sich um hochsensible Gesundheitsdaten handelt. Dennoch zeigen Befragungen, dass viele Patient:innen bereit sind, solche Technologien zu nutzen, wenn sie daraus einen konkreten Nutzen ziehen (Rodler et al., 2019).
Praxisbeispiel: coobi
Ein Anwendungsbeispiel für die Umsetzung digitaler Biomarker in der Suchttherapie ist coobi. Die Plattform kombiniert Daten von Wearables, Smartphones und Nutzer:innen-Eingaben in der App coobi care, um basierend auf diesen Daten neue Erkenntnisse, Zusammenhänge und Veränderungen aufzuzeigen und auf die Situation der Nutzer:innen zugeschnittene Interventionen bereitzustellen.
coobi kombiniert mehrere Schritte zur Erfassung und Auswertung digitaler Biomarker. Zunächst werden verschiedene digitale Biomarker gesammelt, darunter Herzfrequenzparameter wie Ruhepuls und HRV und Aktivitätsparameter wie Schrittzahl oder aktive Minuten. Ergänzend zur passiven Datenerfassung erhebt coobi regelmäßig Patient-Reported Outcomes (PROs). Über kurze, strukturierte Fragebögen in der App geben Nutzer:innen aktiv Auskunft zu ihrer Stimmung, ihrem Craving, ihrem Stresslevel, ihrer Schlafqualität und ihrem Konsum. Diese subjektiven Angaben werden gemeinsam mit den objektiven Biomarker-Daten ausgewertet, um ein ganzheitliches Bild der aktuellen Belastungssituation zu erhalten. Für jede/n Nutzer:in wird für die Parameter ein persönlicher Normalbereich definiert. Kommt es zu Abweichungen, werden den Nutzer:innen sofort passende Unterstützungsangebote bereitgestellt. Dazu gehören Atemübungen, CBT-basierte Lernmodule, digitale Notfallkontakte oder reflektierende Impulse, abrufbar in Echtzeit und unabhängig von Ort und Zeit. Zugleich bietet coobi care behandelnden Therapeut:innen ein Dashboard, in welchem die Daten, mit Zustimmung der Nutzer:innen, über den aktuellen Zustand ihrer Patient:innen eingesehen werden können. So kann die Kommunikation mit Patient:innen noch gezielter angeboten werden und kritische Veränderungen können frühzeitig erkannt werden. Dieses Zusammenspiel aus digitalem Monitoring, intelligenter Analyse und individualisierter Intervention macht coobi zu einem beispielhaften Anwendungsfall für digitale Biomarker in der Suchttherapie.
Das Ziel von coobi ist es, einen Algorithmus zu entwickeln, der Rückfallrisiken und Krisen frühzeitig erkennt und die bestmögliche Unterstützung bereitstellt. Dadurch sollen in Zukunft Rückfälle aktiv verhindert werden und so die langfristige Abstinenz der Nutzer gesichert werden.
Im Rahmen einer Partnerschaft mit coobi stellt Lifespring Patient:innen in den letzten Wochen ihrer Therapie und in der Zeit nach der Entlassung die coobi care App und eine Garmin-Smartwatch zur Verfügung. So wird eine nahtlose digitale Begleitung auch über den Klinikaufenthalt hinaus möglich. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht Lifespring den Anspruch, Therapie auf höchstem Niveau anzubieten und gleichzeitig die Entwicklung innovativer Technologien voranzutreiben, die das Potenzial haben, die Versorgung nachhaltig zu verändern.
Fazit
Digitale Biomarker verändern die Art und Weise, wie Suchterkrankungen erkannt, überwacht und behandelt werden. Ihr größtes Potenzial liegt in der frühzeitigen Erkennung individueller Risikomuster, lange bevor eine Krise oder ein Rückfall tatsächlich eintritt. Studien zeigen, dass Veränderungen in physiologischen und verhaltensbezogenen Parametern valide Hinweise auf Craving, Stress oder depressive Episoden liefern können. In Kombination mit tragbaren Technologien, Algorithmen zur Mustererkennung und therapeutischen Angeboten entsteht ein neuer, personalisierter Ansatz zur Rückfallprävention. Gleichzeitig bestehen noch Herausforderungen bei der Standardisierung, Datenintegration und technischen Genauigkeit. Doch das Forschungsinteresse ist groß, und mit Plattformen wie coobi zeigen sich bereits heute konkrete Anwendungsmöglichkeiten im klinischen Alltag. Digitale Biomarker könnten die Suchttherapie in Zukunft nachhaltiger, individueller und vorausschauender gestalten und haben das Potenzial, die noch hohen Rückfallraten zu reduzieren.
Literaturverzeichnis
Avram, R., Olgin, J. E., Kuhar, P., et al. (2020). A digital biomarker of diabetes from smartphone-based vascular signals. npj Digital Medicine, 3(1), 1–7.
Buegler, M., Harms, R., Balasa, M., et al. (2020). Digital biomarker-based individualized prognosis for people at risk of dementia. Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 12(1), e12073.
Carreiro, S., Smelson, D., Ranney, M., et al. (2020). Wearable sensor-based detection of stress and craving in patients during treatment for substance use disorder: A mixed methods study. Drug and Alcohol Dependence, 206, 107697.
Coravos, A., Khozin, S., & Mandl, K. D. (2019). Developing and adopting safe and effective digital biomarkers to improve patient outcomes. npj Digital Medicine, 2(1), 1–5.
Ford, J., & Corkey, B. (2023). Scaling digital biomarker discovery with the cloud and wearable devices. Trends in Pharmacological Sciences, 44(1), 1–4.
Juarascio, A. S., Goldstein, S. P., Manasse, S. M., et al. (2020). Momentary changes in heart rate variability can detect risk for emotional eating episodes. Appetite, 150, 104651.
Kalali, A., Cummings, J., & Rosenblat, J. D. (2019). Digital Biomarkers in Clinical Drug Development. Innovations in Clinical Neuroscience, 16(1–2), 13–16.
Kaplan, R. M., Chambers, D. A., & Glasgow, R. E. (2023). Big data and wearable technology: Hope, hype, and scientific promise. JAMA, 329(4), 283–284.
Meister, S., Becker, S., Hilbich, L., et al. (2016). Digital health and digital biomarkers–enabling value chains on health data. Bundesgesundheitsblatt–Gesundheitsforschung–Gesundheitsschutz, 59(3), 305–310.
Motahari-Nezhad, H. R., Safdari, R., Ghazisaeedi, M., et al. (2022). Digital biomarker–based studies: Scoping review of systematic reviews. Journal of Medical Internet Research, 24(1), e30368.
Rodler, S., Kaulfuss, S., Stief, C., et al. (2019). Patients’ perspective on digital biomarkers in advanced urologic malignancies. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 37(10), 797.e1–797.e7.
Seyhan, A. A., & Carini, C. (2019). Are innovation and new technologies in precision medicine paving a new era in patient centric care? Journal of Translational Medicine, 17(1), 1–13.
Snyder, C. F., Jensen, R. E., Segal, J. B., & Wu, A. W. (2018). Patient-reported outcomes (PROs): Putting the patient perspective in patient-centered outcomes research. Medical Care, 56(1 Suppl), S1–S2.
Wen, D., Zhang, X., & Liu, X. (2017). Evaluating the consistency of current mainstream wearable devices in health monitoring: a comparison under free-living conditions. Journal of Medical Internet Research, 19(3), e68.
Wicks, P. (2015). The potential of digital patient data. Nature Biotechnology, 33(5), 450–451.
Zhang, Y., Song, H., Shen, Z., et al. (2019). Automated voice biomarkers for depression symptoms using an android mobile device: A pilot study. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 23(1), 44–53.